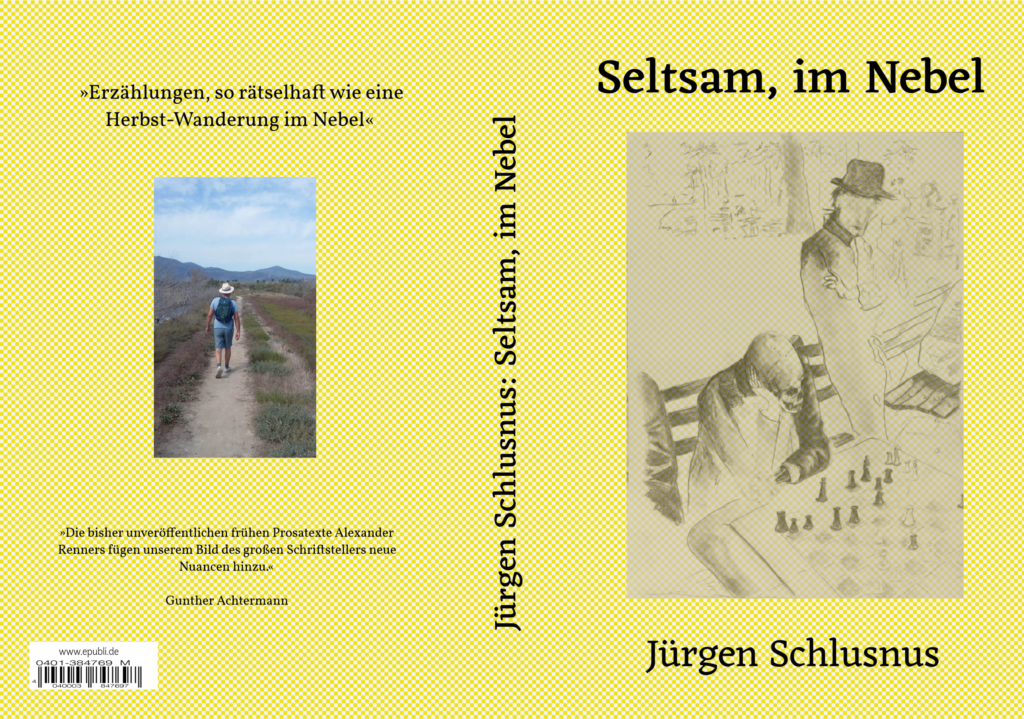
Leseprobe:
Einsamkeiten, Gemeinsamkeiten, Pfingstsamstag im Wohnblock am Rande der Stadt
Rita von Bockstette, nicht mehr unbedingt attraktiv, hält starke Stücke auf sich; einer ihrer Vorzüge, meint sie, sei ihre Intelligenz. Eigentlich sollte sie die unerwartet freien Tage nutzen, um den Kleinkram, der vom Umzug liegengeblieben ist, zu sortieren, aber sie verschiebt das auf ein anderes Mal.
Diese Tage muss frau dem Leben gewinnen, sagt sie sich und überlegt.
Seit sie halbwegs regelmäßig mit dem deutlich jüngeren Axel verkehrt, hat sie aufgehört, sich das Haar zu färben. Axel nämlich findet es erregend, wie er sagt, mit einer Frau zu schlafen, die seine Mutter sein könnte. Rita beschließt, da Axel nicht anruft, ihren Körper in die Badewanne zu legen. In ein paar Jahren wird sie fünfundfünfzig, und das sähe, wer Rita in der Badewanne beobachten könnte. Auch sie selbst ist nicht blind, und also wird sie Axel anrufen. Sie sieht nicht ein, warum sie (als Frau, wie sie immer wieder betont) Männer wegen leiden sollte, aber sie weiß auch, dass das mit zunehmenden Alter nicht immer zu vermeiden sein wird. Davor schützt sie selbst ihre Klugheit nicht.
Ebenfalls neu in den Wohnblock eingezogen ist Achtermann, der seine Wohnsitznahme hier als Provisorium betrachtet. Er wird sich über kurz oder lang eine andere Wohnung suchen, eine einem C 4-Linguistikprofessor angemessenere. Das steht fest, pflegt er zu sagen, wie das Amen in der Kirche. Der Mensch im Allgemeinen und ein Linguist wie Achtermann im Besonderen braucht eine Warte, von der aus er Umschau halten kann, in diesem Falle eine größere und repräsentativere Wohnung, in der er dann endlich auch die Bücher aus den Umzugskartons in die Regale sortieren könnte. Als Sprachwissenschaftler muss man aber auch schon mal improvisieren können. Achtermann nennt das mit der ihm eigenen Bildlichkeit »vom Finger in den Hals leben«. Diese Improvisationsgabe entwickelt sich fast zwangsläufig im Verlaufe einer noch jungen Wissenschaftskarriere. Er sei Pragmatiker, sagt Achtermann denn auch, jedweder Dogmatismus sei ihm aus tiefstem Herzen verhasst.
In seiner Mansardenwohnung unterm Dach leidet der Physiker Ulli Wöhler am langen Wochenende. Morgen und übermorgen bleibt wegen der Pfingsttage die Post aus. Vor einigen Wochen, kurz vor seinem fünfunddreißigsten Geburtstag, hat er seinen Bart abrasiert und sich neu eingekleidet. Das passt alles nicht mehr aufeinander, hat er gesagt, und sich Parfum, Hanteln und einen schweren Boxsack zugelegt. Freunde von damals schauen zwar skeptisch und meinen, er sehe jetzt aus wie ein Piffer, in den Hosen und ohne Bart, aber Ulli kümmert sich nicht um das Geschwätz der Leute. Man muss auf der Höhe der Zeit bleiben, sagt er, gerade als Physiker, und geht meist schnell weiter. Wirklich verstanden fühlt er sich eigentlich nur noch von seinem Freund Heinz. Der hat ihm zu seinem Geburtstag einen quittengelben Lederschlips geschenkt. Das macht schon was her, hat Heinz gesagt, und sogar Anne ist ganz angetan von Ullis neuem Bild von sich.
Auch heute am Pfingstsamstag alle Hände voll zu tun hat Hubert Katz. Als Croupier im Casino am See wird ihm Nacht für Nacht ein unerhörter Einsatz abverlangt, von dem niemand sich eine Vorstellung machen kann. Unter der drückenden Last der Verantwortung und des Schicksals, das er zu lenken hat, verliert er regelmäßig große Mengen Flüssigkeit, was dazu geführt hat, dass er für sein Alter ungewöhnlich schlank geblieben ist. Besonders jüngere Männer halten ihn deswegen manchmal für homosexuell, aber damit muss Katz leben, so etwas sei, so definiert er es, »das Äquivalent für das exponierte soziale Ambiente«, das der verantwortungsvolle Umgang mit fremdem Hab und Gut fast zwangsläufig mit sich bringt.
Die beiden bebrillten jungen Damen, die elegante Uschi Osterloh und die etwas schlichtere Betty Szapanski, die gemeinsam aus dem Oberfränkischen zu Besuch gekommen sind, sind so gesehen reiner Luxus. Uschis Rock zum Beispiel ist bis hoch zum Hüftknochen geschlitzt, und wenn sie darauf verzichtet, einen Slip zu tragen, dann ist das, findet Katz, eine schon sehr eindeutige Stellungnahme zu seinen Gunsten.
Eine eher tragische Figur macht heute Gerdes, der Hauswart. Über alle Vorkommnisse im Wohnblock, auch über die vermutlich demnächst erst eintretenden, ist er gewöhnlich gut informiert. Heute jedoch wird er von dem völlig unerwarteten Besuch seiner Mutter überrascht. Als die alte Dame an der Wohnungstür läutet, schafft er es gerade noch, ein unverfängliches Fernsehprogramm einzuschalten.
Gerdes sieht aus dem Fenster und sieht seinen Junior, mit dem er das in wenigen Minuten beginnende Pokalfinale verfolgen wollte, pfeifend mit seinem Rennrad angefahren kommen, sieht, wie er den gelben Golf der Oma erkennt und wie er, ohne auch nur andeutungsweise hochzusehen und lange zu überlegen, auf der Stelle umdreht. Der Satansbraten, denkt Gerdes, weil er weiß, dass Junior sich das Fußballspiel bei seinem Kumpel ansehen wird.
Als Oma nach dem Kuchen, den sie vorsichtshalber mitgebracht hat, von den Nachbarn anfängt, hält Gerdes den Zeitpunkt für erreicht, wo der Rasen noch einmal gemäht werden müsste. »Mach doch einen schönen Spaziergang, Oma«, schlägt er vor, »bei dem Wetter.«
Draußen holt er tief Luft. Seinem Junior, das steht schon mal fest, wird er was erzählen. Sich so billig aus dem Staub zu machen, das hält Gerdes nicht unbedingt für pflichtgemäßes solidarisches Verhalten.
Wenn Ulli die beiden, Heinz und Anne, alle paar Monate mal in ihrem Düsseldorf besucht, dann fühlt er sich endlich wieder einmal geborgen und gut aufgehoben. Zu seinen Ehren macht Anne ihre vorzüglichen, aber aufwendigen elsässischen Teigwickel, und nach dem Brandy spielen die beiden Männer Schach. Ulli hat schon mal überlegt, ob er Heinz vorschlagen sollte, ein paar Partien um Anne zu spielen, aber der Ausgang wäre ungewiss, und eigentlich liebt Ulli die Verhältnisse, wie sie sind: nicht endgültig. Anstandslos räumt Heinz das Schlafzimmer, wenn Ulli kommt, und der weiß das durchaus zu schätzen: »Auch die Eskimos«, sagt er, »bieten ihren Gästen die eigene Frau an.« Nicht zuletzt deshalb hat sich sein anfangs eher distanziertes Verhältnis zu Heinz immer mehr zu einer echten Männerfreundschaft entwickelt. Zuerst war es nicht leicht gewesen für Ulli, als Heinz plötzlich auftauchte und Anne sich erst Hals über Kopf in ihn verliebte und dann sehr bald heiratete. Aber Ulli wäre nicht der Physiker, der er ist, wenn er nicht wüsste, die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Heute ist alles wieder im Lot, und neuerdings kann es sogar vorkommen, dass die beiden Männer allein losziehen, um in den Altbierkneipen zwischen all den Studenten zu sitzen, und Anne in der geräumigen Vierzimmerwohnung allein lassen.
Nein, für Axels unvermutete Fußballbegeisterung kann Rita heute kein Verständnis aufbringen. »Das Spiel«, hat Axel ihr am Telefon vorgerechnet, »fängt um vier an und dauert neunzig Minuten, dazu die Halbzeit, ich bin, sagen wir, gegen sechs bei dir, wenn es keine Verlängerung gibt.«
Vor zehn Jahren hätte sich Rita damit nicht abgefunden, heute jedoch, weiß sie, muss sie zufrieden sein, mit dem was sie kriegt, auch wenn sie zu wissen meint, dass das Rascheln in der Leitung von einer Kartoffelchipstüte herrührt und nicht, wie Axel etwas angestrengt behauptet, von einer kurzzeitigen Empfangsstörung im Fernsehen. Ihrem Einwand, er könne das Spiel, wenn es denn nun partout sein müsse, doch auch bei ihr und mit ihr sehen, kann Axel zu seinem Glück und mit Recht entgegenhalten, dass die beiden Mannschaften schon auf dem Platz sind. Rita legt auf und beschließt, sich, um Klarheit zu gewinnen, ebenfalls das Spiel anzusehen, um ihn hinterher mit kleinen und unauffälligen, aber gezielten Fragen auf die Probe zu stellen.
In seinem Fernsehsessel bequem gemacht hat es sich auch der LKW-Fahrer Hasselhoff. Seine junge Frau hat er angewiesen, die beiden Mädels zu beschäftigen und die Störungen auf das Unvermeidliche zu reduzieren.
Aus den Nachrichten vor dem Endspiel hat Hasselhoff erfahren, dass irgendwo in Südamerika die Erde gebebt hat. Junge, Junge, denkt er, zwanzigtausend Tote, das ist ja eine ganze Kleinstadt. Und dann versucht er sich auszumalen, wie viele Fußballplätze man bräuchte, um diese zwanzigtausend toten Indios nebeneinander zu legen. Weil er nicht genau weiß, welche Maße ein Fußballfeld hat, zeichnet er sich einen Plan. Ein zehn Zentimeter langes Rechteck hat etwa dann das Format eines vernünftigen Fußballplatzes, wenn es sechseinhalb Zentimeter breit ist. Ein richtiges Feld wird demnach etwa hundert Meter lang und fünfundsechzig Meter breit sein. Hasselhoff schaut an sich herunter und schätzt, dass er, wenn er die Arme eng an den Körper legt, etwa fünfzig Zentimeter breit ist. Das macht bei einer Körpergröße von einsachtzig – Hasselhoff steht auf und holt sich aus dem Kinderzimmer den Taschenrechner, den seine älteste Tochter für die Schule braucht – das macht bei einer Körpergröße von einsachtzig: neuntausend Quadratzentimeter, sagen wir also knapp einen Quadratmeter. Ein Fußballplatz hat etwa, vorausgesetzt, seine Zeichnung stimmt, sechstausendfünfhundert Quadratmeter. Wenn man nun also die Leichen einigermaßen säuberlich nebeneinander legt, passen über den Daumen sechstausendfünfhundert tote Indios auf ein Feld. Hasselhoff ist verblüfft: Die zwanzigtausend Toten kriegt man bequem auf drei Fußballplätzen unter. Er ist ein wenig stolz auf seine Rechnereien und findet das mit der Kleinstadt gar nicht mehr so dramatisch.
[…]